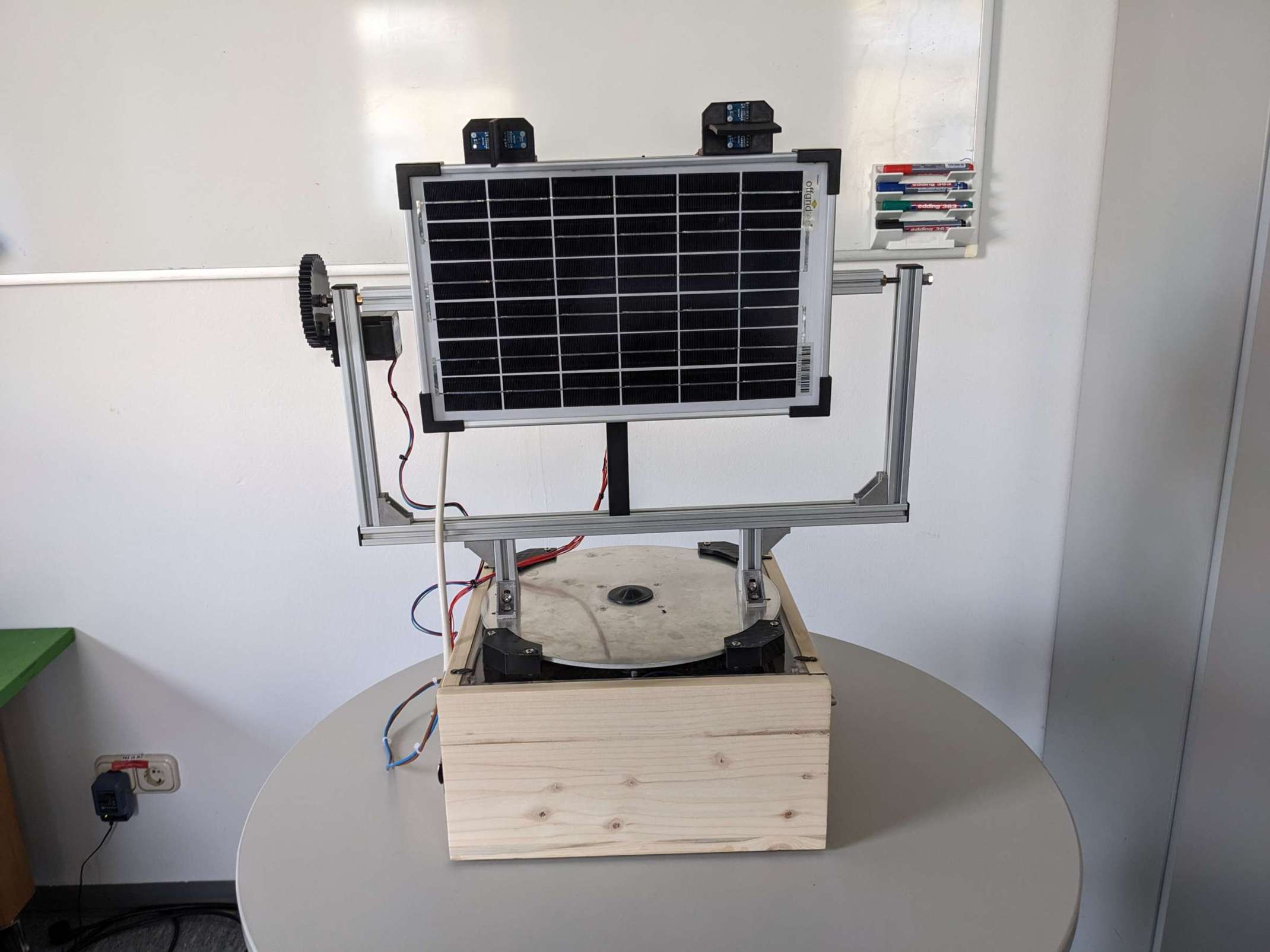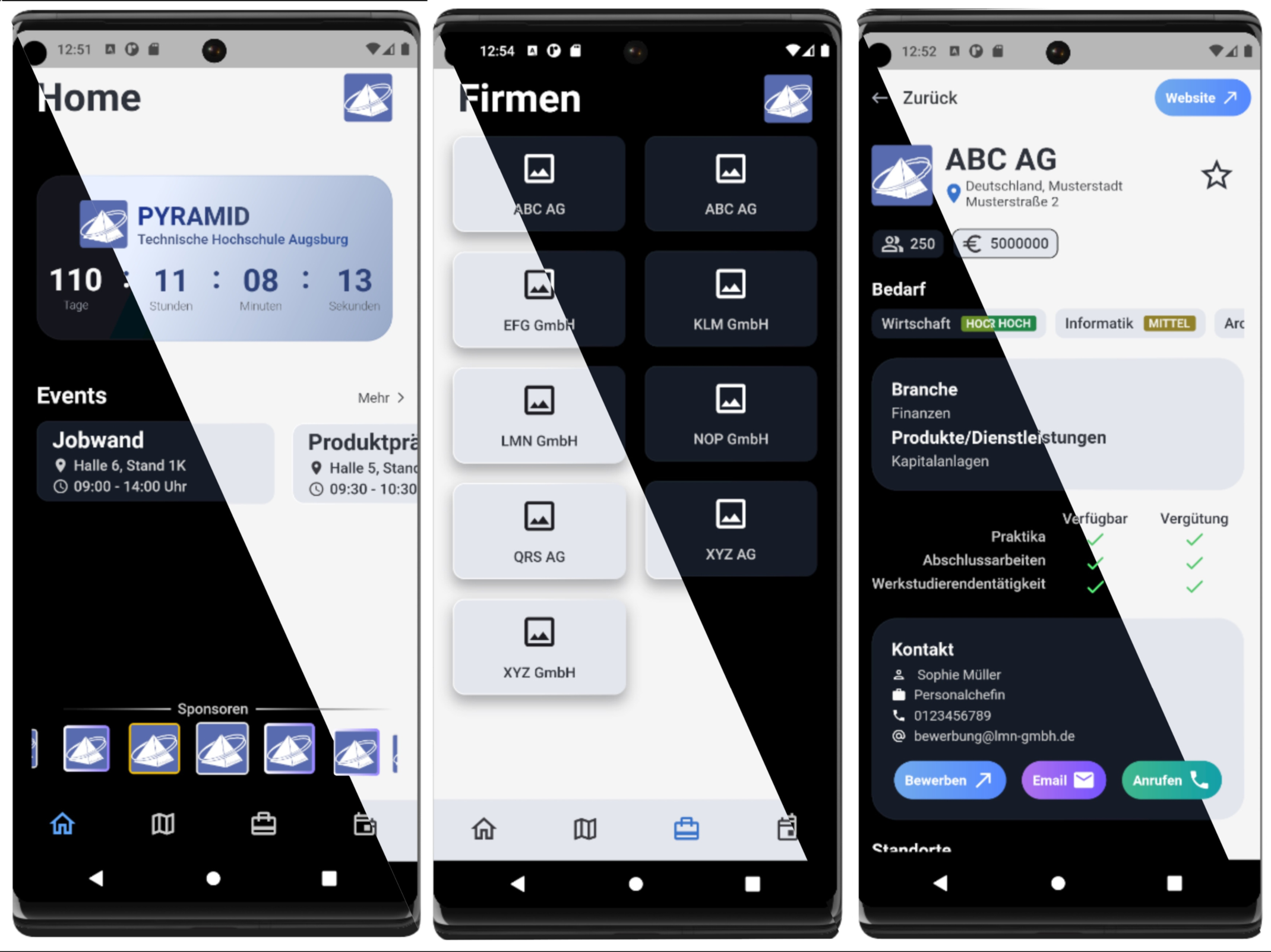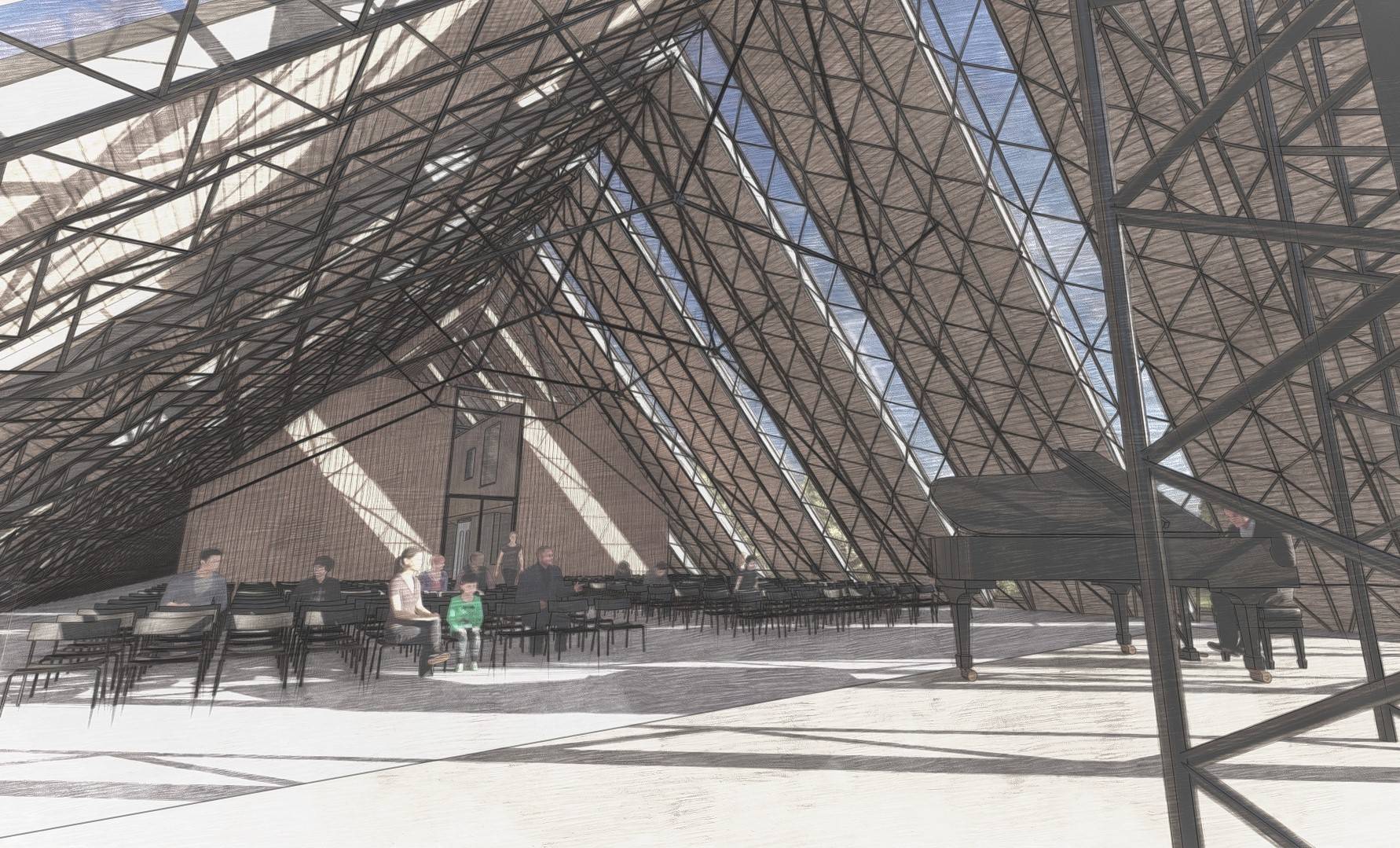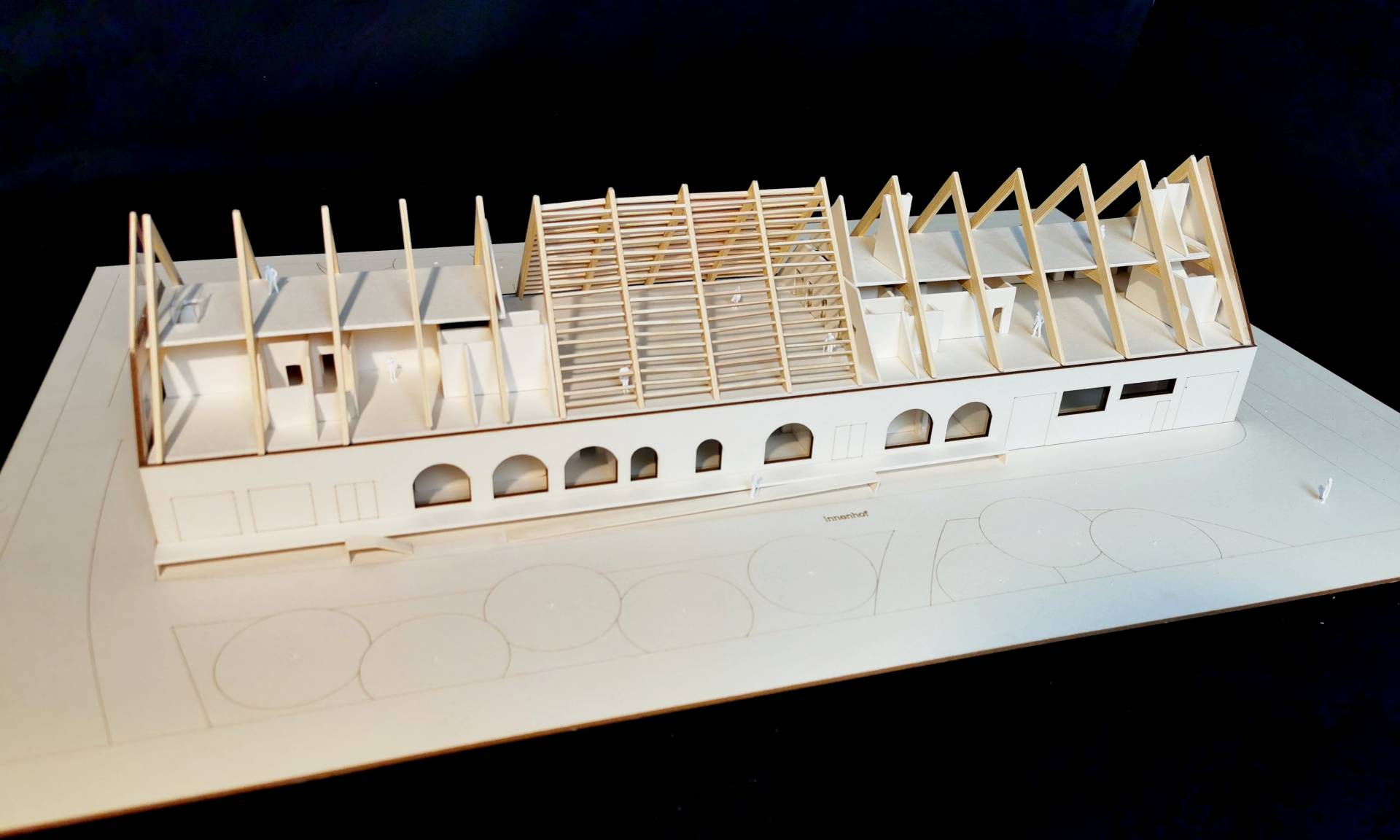Futtertrocknung Einteilungsbuch
Derzeit melden die Landwirte der Futtertrocknung Lamerdingen ihre zu verarbeitende Menge an Grüngut zu einem von Ihnen gewählten Termin ca. 1- 3 Wochen vorher telefonisch an. Die Menge wird vom Landwirt anhand seiner Erfahrung geschätzt. Diese Daten werden vom Produktionsleiter in ein Formblatt handschriftlich eingetragen. Sobald der Termin erreicht ist, wird in gegenseitiger Absprache die Mahd veranlasst, die Abholung organisiert und die Verarbeitung durchgeführt.
Da einige Mitarbeiter keinerlei Textverarbeitungskenntnisse besitzen, wäre eine Handschrifterkennung von großem Vorteil. Genaue Anforderungen für die konkrete Projektarbeit werden gemeinsam mit den Projektpartner erarbeitet. →